Kulturraum Stadt – Bedarfe und Marktchancen einer kulturorientierten Freizeit
Hilke Groenewold, Dr. Petra Zadel-Sodtke
Kulturraum Stadt – Bedarfe und Marktchancen einer kulturorientierten Freizeit
Um den Komplex Belange und Marktchancen einer kulturorientierten Freizeit gut begreifen zu können, nähern wir uns dem Thema zunächst theoretisch über die Begriffe Freizeit, Stadtraum und Kultur. Daraus entwickelt, betrachten wir die Marktchancen des Designs für Alle in Zusammenhang mit der Erlebbarkeit von Kultur im städtischen Freiraum.
Freizeit
Im Hinblick auf die Freizeit, in der die kulturellen Angebote wahrgenommen werden sollen, kann unterschieden werden nach der Art und/oder Dauer der freien Zeit, das heißt nach den Zeitfenstern der potenziellen Kunden bzw. Adressaten. Dies sind Ferien, Urlaub, Reisezeit, Sonntag und Wochenende; branchenbezogene Ruhetage; tägliche Feierabende, Abendstunden; Mußestunden; Arbeitspausen bzw. Arbeitsruhe und Mittagspausen; kurze Ruhepausen, Rast und Verschnaufpausen.
Stadtraum und Kultur
Den Kulturort Städtischer Freiraum betrachten wir nicht in seiner räumlichen Ausdehnung, sondern als Netz von Funktionen, die im Kontext der gesellschaftlichen Situation und Entwicklung stehen. Der städtische Kulturfreiraum befindet sich mitten in der Gemeinde. Es ist ein Gesellschaftsraum von Bewohnern, Besuchern und Touristen. Es sind nicht nur kulturelle Institutionen, Kommunen und Akteure, sondern auch die Bürger selbst, die Kultur schaffen. Der städtische Kultur-Außenraum ist zudem auch Image, das je nach Personengruppe verschieden wahrgenommen wird und deshalb auch emotional verschieden wirkt. Je ansprechender das Image des städtischen Kulturaußenraumes für alle ist, umso positiver ist die Identifizierung mit der Stadt für die Bewohner und Besucher, gleich ob Bürger oder Tourist. Ziel von Konzept und Ausgestaltung der Kulturfreiräume sollte es sein, einen respektvollen Umgang mit der menschlichen Verschiedenheit zu fördern, wobei die Würde aller gleichermaßen geschützt und gewahrt wird. Gleichzeitig sollte die kulturell interaktive Nutzung angeregt werden. Und das ebenso erstrebenswerte dritte Ziel besteht darin, die Grundbedürfnisse des Menschen bezüglich Sicherheit, Zugehörigkeit, Wertschätzung und Selbstverwirklichung zu bedienen.
Der Stadtraum hat als Raum für kulturorientierte Freizeit viel zu bieten: Straßen, Wege und Plätze; Stadtgrundriss, Fassaden und Oberflächen; Baustile, Konstruktionen und Materialien; Parks, Grünflächen und Straßenbäume; Flüsse, Kanäle und Bäche; Industrie, Schienen und Brücken. Vor allem aber hat der Stadtraum eines zu bieten: Aufenthaltsqualität für Menschen. Und als städtischer Kulturraum beinhaltet er Zeugnisse des Zeitwandels und ist reell begehbares, erlebbares Exponat!
Der Stadtraum für kulturorientierte Freizeit für alle kann beispielsweise betrachtet werden als:
- a. erlebbares Kulturmuseum,
- b. durchschreitbares Denkmal der Stadtgeschichte. Wobei die Geschichte nicht nur als abgeschlossene Vergangenheit zu verstehen ist, sondern auch als Ressource für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft.
- c. bespielbare Bühnen, für die interessante, leere oder nichtssagende Stadträume genutzt werden können,
- d. verbindende Infrastruktur einer Ausstellung mit identitätsstiftenden Gestaltungsleitlinien im Corporate Design der jeweiligen Stadt oder Kommune,
- e. Ort für Angebote und Dienstleistungen für dauerhafte Nutzungen, Zwischennutzungen und temporäre Aktionen.
Marktchancen
Die Basis der Marktchancen für kulturelle Produkte und Dienstleistungen im städtischen Außenraum bilden mehrere Aspekte, die zunächst nicht gerade ökonomisch förderlich erscheinen. Sie erfordern jedoch ein Umdenken. Und unter einer positiven und kreativen Betrachtungsweise inspirieren sie zu neuen Produkten und Dienstleistungen einer kulturorientierten Freizeit, zunächst als Nischenprodukte, die sich durch ihre Zukunftsorientierung regional und/oder global etablieren können.
Diese Aspekte sind:
- der demografische Wandel im Sinne von älter, bunter und weniger
- die geänderte Gesetzeslage, aufgrund der gültigen UN-Behindertenrechtskonvention (Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung) und der daraus resultierenden staatlichen und landesbezogenen Aktionspläne sowie der zyklisch zu erstellenden Rechenschaftsberichte. Zur geänderten Gesetzeslage gehören natürlich auch das Antidiskriminierungsgesetz sowie die Behindertengleichstellungsgesetze
- die ungeliebte Finanzkrise, die durchaus positive Erneuerung bringen kann, etwa eine neue Herangehensweise mit gesellschaftsorientiertem Verantwortungsbewusstsein
- die Mediterranisierung des Außenraumes durch Belebung und Aneignung.
- die Expansion des Kultur-Begriffs im Sinne von Pluralismus, bedingt durch Migration Europäische Union und Globalisierung.
Zur kulturellen Erkundung der Stadträume sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Orientierung, Wege und ○ Mobilität im Sinne von Zugänglichkeit und Erreichbarkeit
- Exponate und Veranstaltungen ○ Führungsund Vermittlungsangebote
- Leicht auffindbare Informationen im Vorfeld
Orientierung und Wege
In den meisten Kommunen ist die Ausschilderung zu den jeweiligen Veranstaltungsorten bzw. eine selbstständige Orientierung im Stadtraum nur unzureichend gelöst. Dieser Mangel ist eine hervorragende Marktchance – denn trotz Orientierungspunkten wie zum Beispiel markante Gebäude, Plätze oder Verkehrsknotenpunkte – empfiehlt es sich, entlang von Routen Leitpunkte zu setzen. Bei komplexen Flächen, wie bei Busbahnhöfen und Bahnhofsvorplätzen, sind Orientierungspunkte grafisch und taktil erfassbar darzustellen (s. Abb.1).

Zur Orientierung ist die Leitung so zu gestalten, dass gerade Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Informationen über die zu erwartenden Entfernungen, Treppenlängen, Neigungsverhältnisse zu topografischen Verhältnissen usw. erhalten, um möglichst ohne Umwege von A nach B zu kommen.
Um ein verständliches Netz von Orientierungselementen zur Erfassbarkeit eines Stadtraumes vorzunehmen, ist eine stadtspezifische Anordnung von orientierenden Leitpunkten zu prüfen. Dabei sind die erfassbaren Bereiche in einer Stadt zu analysieren und die möglichen Übergabebereiche und umwegfreien Wege zu untersuchen. Die Abb. 2 zeigt, übertragen auf einen touristischen Stadtteil von Rom, ein mögliches Netz potenzieller Leitpunkte mit deren Informationsradien.

Diese Orientierungspunkte bzw. Informations-Leitpunkte können so gestaltet sein, dass sie bereits von weitem als klar erkennbare Bezugsund Übergabeelemente im Stadtraum erkennbar und klar zugeordnet werden können. Zudem können diese zum Corporate Design einer Stadt beitragen. Diese Stationen bzw. Punkte der Informationsvermittlung sind in ein Leitsystem zu integrieren, damit die Hinführung auch gewährleistet ist. Sie sind zu versehen mit den wesentlichsten Informationen zum Ort, einschließlich des nahen Umfeldes wie Standort, Sehenswürdigkeiten, Sitzgelegenheiten, Sanitäranlagen etc. Hierbei ist die Wahrnehmbarkeit im Sinne des Designs für Alle selbstverständlich (Zwei-Sinne-Prinzip, Tastplan, Brailleamp; Profilschrift, Leuchtdichtekontrast, elektroakustische Orientierungssysteme).
Mobilität
Bezüglich einer Mobilität für alle sind vor allem Marktchancen für Dienstleistungen im Bereich der Ausleihe möglich. Hierzu ist wünschenswert, dass die neue AltenGeneration einerseits selbstbewusst mit ihren körperlichen Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen umgeht und aufgrund eines attraktiven Designs andererseits ohne Scham das für sie angenehmste Hilfsmittel nutzen kann.
Ausleihbare Hilfsmittel für Gehbehinderte können beispielsweise Rollstühle und Elektro-Scooter sein.
Für Rollstuhlnutzende können je nach Situation des Stadtraumes und des Bodenbelages Breitreifenrollstühle, Mini-Tracks oder Handbikes zur Ausleihe angeboten werden - mit Unterweisung des Verleihers und jeweils individuellen Anpassungen.
Zur Erschließung von Städten, in denen man sich gut per Fahrrad bewegen kann, ist das Anbieten von Tandems sinnvoll. Personen mit Gehbehinderungen, Sehschwäche oder kognitiven Einschränkungen können so gemeinsam mit Freunden und Angehörigen eine Stadt erleben und gleichzeitig kommunizieren.
Für Blinde können tastbare Stadtpläne aus geprägtem Kunststoff mit ertastbaren Gebäuden und Straßen ausleihbar sein. Hierbei sind zwecks Einordbarkeit Punkte auf den Stadtrouten zu installieren. Auch können als Spezialnavigationsgeräte für Städte z.B. Spezialblindenstöcke mit integriertem Wiedergabegerät in Kombination mit RFID Chips ausgeliehen werden.
Auch Bringdienste, ob als kostenpflichtiges Angebot oder selbstorganisiertes Nachbarschaftsmodell, können mögliche Dienstleistungen sein.
Exponate und Veranstaltungen
Exponate im Stadtraum, die von künstlerischer oder stadthistorischer Relevanz sind, sind in der Regel skulpturale, bildliche, textliche und manchmal auch filmische oder akustische Zeugnisse bestimmter Gebäude, Stadtsituationen, Orte, Skulpturen oder Anlagen. Im Sinne des Designs für Alle ist bei Exponaten vor allem auf eine Gestaltung zu achten, die mehrere Sinne gleichzeitig anspricht. Dies macht nicht nur das Aufnehmen von Informationen bei veränderten Sinneswahrnehmungen möglich, sondern auch ein ganzheitliches Lernen. Auch künstlerische Darbietungen wie schauspielerische oder musikalische Veranstaltungen, die den städtischen Außenraum als Kulisse verwenden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Beispiele für Ausstattungselemente
Sind zu städtischen Exponaten, wie Architekturen, Freiräumen, Kunstobjekten, Informationsorten etc. nur Texte und Bilder vorhanden, so sollte eine Möglichkeit zum Abrufen von Audioinformationen (Audiodeskription) gegeben werden, die Beschreibungen zu dem zu Sehenden beinhalten. Wichtige Texte können in Gebärdensprache gedolmetscht dargeboten werden, zum Beispiel über einem Film vor Ort oder abrufbar über eine Internetadresse, die mit Hilfe von QR-Codes (s. Abb.3) und dem eigenen Android-Handy abgerufen werden können.
Bei Filmpräsentationen sollten eine Untertitelung für Gehörlose sowie Zusammenfassungen in Gebärdensprache angeboten werden. Je nach Standort bzw. Internationalität eines Touristenstroms ggfs. auch als mehrsprachige Untertitelung.

Bei Klangoder Sprachelementen ist, um für Hörgeräteträger eine störungsfreie Aufnahme der akustischen Signale zu ermöglichen, eine Induktionsschleife oder andere für Hörgeräte geeignete Höranlage anzubieten. Eine Induktionsschleife kann je nach Material des Exponats entweder direkt im Exponat oder im unmittelbaren Umkreis dessen angebracht werden. Beide Varianten sind nicht kostenintensiv.
Über QR-Codes können in Zusammenhang mit internetfähigen Mobiltelefonen oder RFID Chips mit entsprechenden Lesegeräten Texte, sowie Videodateien mit Gebärdensprache und Audiodateien – auch in Leichter Sprache – zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig können für spezielle Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche, Experten oder Gehörlose gesonderte Informationen bereitgestellt werden. Informationen mit einmaligen Herstellungskosten können somit von allen interessierten Nutzergruppen immer wieder aufgerufen werden. Barrieren werden hier vergleichbar mit einer Rampe für viele abgebaut, und somit ist eine solche Maßnahme aus volkswirtschaftlicher Sicht rentabel.
Taktile Medien bzw. Tastelemente (s. Abb. 4) weisen durch figürliche Reduzierung eine künstlerische und analysierende Qualität auf, die vielen zu Gute kommt. Generell sind bei der Herstellung von taktilen Medien Betroffene und Spezialisten einzubeziehen, da der Grad der Erfassbarkeit ein hohes Maß an Spezialistenwissen voraussetzt. Um eine stadträumliche Situation durch Ertasten wirklichkeitsgetreu zu erfahren, sind nicht immer kartografiegetreue Darstellungen angemessen. Sollen bestimmte Eindrücke eines Ortes wirkungsvoll vermittelt werden, so ist das Hochzoomen einzelner Ausschnitte sinnvoll (s. Abb. 5). Bei Tastmodellen ist unbedingt die Haptik des betastbaren Materials zu bedenken. Welches Material ist wirklich zum Anfassen gedacht? Oder hat man danach das Bedürfnis, sich unbedingt die Hände waschen zu müssen bzw. war das Modell nicht doch eher für die Augen gemacht? Entwicklungspotenzial in der Materialentwicklung ist unter anderem bezüglich Selbstreinigung und Witterungsbeständigkeit zu sehen.

a. Tastmodell aus gerostetem Stahl - Material zum Ansehen statt zum Tasten
b. Tastmodell mit hochgezoomten Ausschnitten
Beispiele für innovative Angebote – Informationsstationen
Städtische Exponate bzw. Ausstellungselemente können auch Informationsstationen sein. Die Abb. 5 skizziert die Idee einer Info-Muschel for all, ausgestaltet als Entspannungsstationen im Stadtraum zum Hinsetzen, Liegen, Stehen und Hineinrollen mit Platz für eine Kleingruppe. In der Muschelschale integriert sind die für eine umfassende Barrierefreiheit notwendigen Ausstattungselemente wie Lautsprecher und Monitore für das Abrufen von Texten, Bildern und Filmen mit Untertiteln für Gehörlose, einschließlich integrierter Induktionsschleifen. Solch eine Info-Muschel kann gleichzeitig als Station für Sound-Spaziergänge und als Unterstand bei schlechtem Wetter genutzt werden.

Weitere Informationsstationen für Groß, Klein, Rollende und Gruppen könnten auch Info-Sträuße for all sein (s. Abb. 6). Eine Art umfänglich barrierefrei ausgestatteter Guck-und-Hör-Kasten. Ein zusätzlicher, außen angebrachter QR-Code ermöglicht per Smartphone das Aufrufen einer dazugehörigen Homepage, auf der Videos in Gebärdensprache sowie auditive Informationen für Blinde und Sehschwache sowie in Leichter Sprache hinterlegt sind.
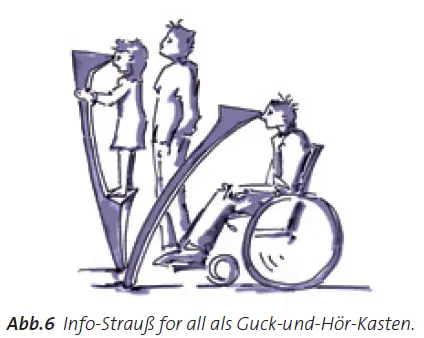
Ausstellungspavillon
Gerade bezogen auf eine kulturorientierte Freizeit können durch ein vielfältiges Angebot von temporären Veranstaltungen viele Produkte und Dienstleistungen im Sinne eines Designs für Alle entwickelt werden. Zum Beispiel ein mobiler, barrierefreier Ausstellungspavillon, der je nach Bedarf umgestaltbar und von verschiedenen Kommunen oder Städten gemietet werden kann. Solch ein bühnenartiger Pavillon kann offen oder verschließbar sein und in der Nacht zum Lichtobjekt werden. Diese mobile Bühne kann das Gesamtpaket für barrierefreie Veranstaltungen inklusiv anbieten: Induktive Höranlage, Filmeinblendung mit Gebärdendolmetscher, Life-Übertitelung und Life-Audiodeskription durch Schriftdolmetscher.
Fitness & Kulturgut – Angebote auf Win-Win-Basis
Insgesamt großes Potenzial sehen wir für Dienstleistungen auf Win-Win-Basis, zumal wenn die Kräfte unserer alternden Gesellschaft in Bezug auf den städtischen Freiraum als Kulturund Kommunikationsort genutzt werden. Die ökonomische Situation zwingt darüber hinaus zu großen staatlichen Sparmaßnahmen, worunter auch die Gemeinden leiden, die wiederum für die Pflege öffentlicher Stadträume bzw. städtischer Freiräume zuständig sind.
Ein Beispiel für innovative Dienstleistungen im öffentlichen Freiraum ist die englische Idee des Green Gym. Green Gym wurde von einem englischen Landarzt als Fitnessprogramm initiiert und die körperlich aktivierende Geschäftsidee vereint drei Bedürfnisse. Erstens pflegen die Teilnehmenden mit Profigartengeräten und unter Anleitung eines Gärtners oder Försters ihre geliebten öffentlichen Gärten, zweitens werden sie unter Anleitung eines Animateurs oder Trainers dabei fit und drittens sind die Teilnehmer in geselliger Runde mit Gleichgesinnten und pflegen in der integrierten Teatime ihre sozialen Kontakte. Diese Dienstleistung freiwilliger Organisationen unter professioneller Anleitung hat in England mittlerweile 200 regionale Green Gyms-Standorte mit teilweise bis zu 400 Mitgliedern. Die Fitness im Grünen mit der Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist ein WinWin-Prinzip für alle Beteiligten. Jeder spart Geld und jeder erreicht etwas Gutes: der Staat, die Gemeinde und die Teilnehmer.
Frage ist: Wie können in Deutschland im Hinblick auf den demografischen Wandel kulturelle Potenziale kanalisiert bzw. in Bezug auf den Kulturraum genutzt werden?
Führungs- und Vermittlungsangebote
Es ergeben sich Marktchancen und eine Fülle von Möglichkeiten, Führungskonzepte als potenzielle Dienstleistungen zu entwickeln. Hierzu zählen zum Beispiel Stadtführungen für Blinde und/oder Sehbehinderte (Audiodeskription und Mehrsinnesstationen). Dabei ist zu bedenken, dass eine Audiodeskription auch für Sehende eine durchaus spannende Annäherung an eine Thematik ist, weil der Erkenntnisprozess des visuell unbewussten Bereiches sozusagen mit einer Audiodeskription offenbart wird. Ebenso können Tast-, Hörund Riechführungen für alle spannend sein. Spezialangebote wie Führungen in Deutscher Gebärdensprache mit Textdolmetschern, mit mobiler FM–Anlage , die für Hörgeräteträger geeignet sind, in Leichter Sprache sowie thematische Stadtführungen für Kinder und Jugendliche sind dem Zeitgeist entsprechende Angebote und sollten so konzipiert und beworben sein, dass Sie möglichst vielen zugutekommen.
Leicht auffindbare Informationen im Vorfeld
Weiterer Bedarf und somit Marktchancen in der kulturorientierten Freizeit ergeben sich im Bereich der Informationen im Vorfeld, die leicht auffindbar und barrierefrei zu erhalten sind. Solche Produkte und Dienstleistungen können sein:
- Gemeinsame Präsentation (Vernetzung) der Akteure bzw. Anbieter von Kultur und Dienstleistungen in einer Stadt oder in einem Quartier (Synergieeffekte)
- Barrierefreie Internetauftritte
- Leichte Navigation zu den jeweiligen Angeboten
- Spezialstadtpläne über barrierefreie Angebote - bei Touristeninformation/ Bürgeramt als Download verfügbar
- Datenbanken mit objektiven und transparenten Kriterien zu barrierefreien kulturorientierten Freizeitangeboten, die den Besucher zu eigenverantwortlichen Entscheidungen befähigen
Fazit
Zurzeit gibt es kaum barrierefreie Produkte und Dienstleistungen für den öffentlich zugänglichen Bereich. Durch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aber entsteht für die öffentliche Hand ein erheblicher Zugzwang, diese zu schaffen. Die Produkte und Dienstleistungen sind nach den Ansprüchen des Design für Alle zu konzipieren, nämlich: befähigend, leicht adaptierbar, ästhetisch und bezahlbar. Die Marktchancen ergeben sich aus der Entwicklung und dem Anbieten von Produkten und Dienstleistungen, auf die die öffentliche Hand zukünftig angewiesen ist.
Bezüglich ganzheitlich barrierefreier Konzepte, Produkte und Dienstleistungen sind interdisziplinäre Netzwerke auf den Ebenen der Ideenfindung, Produktentwicklung und Produktherstellung sowie der Vermarktung sinnvoll. Erforderlich ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Herstellerfirmen, Dienstleistern, Experten und Spezialisten, Designern und Künstlern, Technikern und Ingenieuren Städten und Kommunen und selbstverständlich mit den Betroffenen - den Menschen mit Behinderung, den Senioren und den Kindern.
Mit konsequent barrierefrei gestalteten Produkten und Dienstleistungen werden nicht nur neue Marktpotenziale erschlossen, sondern auch Wettbewerbsvorteile erreicht, da sie mit selbstverständlicher Ästhetik gestaltet sind und durch die vielseitige Nutzbarkeit einen größeren Kundenkreis ansprechen. Auch der globale Markt hat diesbezüglich einen Bedarf und ist diesen Entwicklungen gegen- über offen.
- © FabrikaCr / iStock.com – Header_Website_1460_360_magazin.jpg


